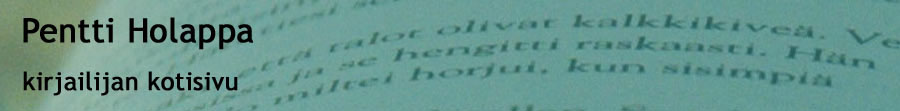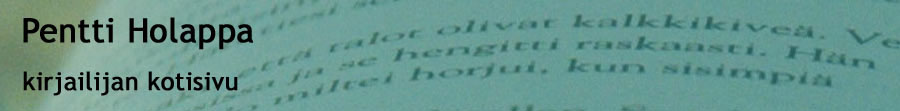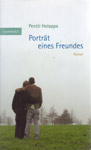

Original:
Ystävän muotokuva
Übersetzung: Stefan Moster
Verlag:
Hainholz, Göttingen, 2002
Seiten: 569
ISBN: 3-932622-84-7
Auf Französisch:
Portrait d'un ami
Mit
diesem Roman hat Holappa 1998 sein Opus Magnum
vorgelegt und dafür den Finlandia-Preis erhalten, die höchste
literarische
Auszeichnung in Finnland. Erzählt wird die leidenschaftliche
Freundschaft
zweier Künstler, und obwohl der Titel das Porträt
eines
Freundes
ankündigt, wird eigentlich ein
Doppelporträt
gezeichnet: das des Malers
Asser Vaho und zugleich das des Ich-Erzählers namens Pentti
Holappa. Als junger
Mann, der davon träumt Schriftsteller zu werden, begegnet er Asser
Vaho und nimmt
ihn als strahlende Verführer, als Lichtgestalt inmitten der grauen
Nachkriegsjahre wahr. Die beiden freunden sich an und erleben gemeinsam
die
Anfangsphase ihres künstlerischen Heranreifens, in der das eigene
Empfinden
nahezu ungefiltert in die schöpferische Arbeit eingeht.
(
Hainholz Verlag)
Leseprobe (S. 14-21):
Als ich Asser Vaho traf, waren wir beide gerade mal
zwanzig Jahre alt. Wir glaubten, Männer zu sein.
In dem Alter werden Jünglinge in den Krieg
geschickt, um sich gegenseitig umzubringen. Dort wird dem Mörder
in ihnen freier Lauf gelassen, der schon seit der Geburt in ihnen
steckt. Weder das Töten noch das Schänden muss man lernen.
Und keine angelernte Fähigkeit verbreitet sich ebenso schnell.
Es war mir gelungen, eine Erzählung und einige
Gedichte in einer Literaturzeitschrift zu veröffentlichen. Die
Hellhörigeren unter den Verlagslektoren waren auf meine Existenz
aufmerksam geworden, das ist wahr. Nach dem Krieg war Literatur in
Mode, und die Verleger sammelten bereitwillig junge Talente für
ihren Stall. Beim Anwerben kamen auch Irrtümer vor, aber das Hobby
war reizvoll genug und kam nicht teuer zu stehen.
Asser war auf seinem Gebiet bereits weiter
vorangekommen als ich. Er war ein Komet. Dabei hatte er so gut wie
nichts tun müssen, um sich diesen Ruf zu erwerben. Es
genügte, dass er einen Raum betrat, und schon wandten sich ihm die
Blicke zu. »Eine wirkliche Begabung«, hieß es. Damit
war gemeint, dass er mehr an sich hatte, als eine vornehme Haltung, ein
schönes Gesicht, einen elastischen Schritt. Man bat ihn um
Illustrationen für Bücher und Zeitschriften - und zahlte
dafür.
Dir fällt bestimmt auf, dass Asser von Anfang
an völlig anders war als ich. Alles fiel ihm leicht.
Wenn ich sage, dass Asser beim Betreten eines Raumes
die andern blendete, stilisiere ich bereits. Wir verkehrten .damals
nicht in Salons, aber ein glänzendes Entrée kann man auch
in einer Studentenbude hinlegen, in einem schmierigen Lokal, ja sogar
auf der Herrentoilette eines Restaurants.
Es war die schlechte Zeit nach dem Krieg, das graue
Jahr 1947. Natürlich hatte man Angst vor der Sowjetunion, welche
die Finnen täglich demütigte, aber wir jungen Leute dachten
vor allem an uns selbst. Wir waren nicht sonderlich an der restlichen
Welt interessiert, sondern an uns selbst und aneinander.
Konzentrationslager, Atomkrieg, biologische Waffen - all das verbannten
wir aus unserem Bewusstsein.
Von heute aus betrachtet, von der Welt der
übergewichtigen und degenerierten Menschen aus, waren wir ziemlich
rührende graue Spatzen, unterernährt und arm. Den
Mädchen fiel natürlich immer irgendetwas ein, womit sie sich
hübsch machten, sie benutzten billige Duftwässer, puderten
sich das Gesicht und malten sich zumindest zum Tanzen die Lippen rot.
Wir Jungen trugen Sachen, die wir von Verwandten
geerbt hatten. Die stammten noch aus der Zeit vor dem Krieg und waren
nun irgendwie auf unsere Maße verkleinert worden. Der Glanz eines
Helden bleibt aber nicht mal unter Lumpen verborgen. Ich meine Asser.
Er sprach mich in der Cafeteria der Universität
an, wo ich saß und in meinen Examensbüchern blätterte.
Ich musste hinaus aus meiner engen Untermietkammer, irgendwohin,
wenigstens meine Altersgenossen anschauen, wenn ich mich schon nicht
traute, auf sie zuzugehen. Damals war mir das beinahe unmöglich,
wie auch heute noch. Du kennst mich ja. Oder?
Ich saß an einem Tisch neben dem Fenster und
bemerkte die anderen Studenten so gut wie gar nicht. Ich sah nur auf
die regenbefleckte Straße hinaus. Es war Herbst. Eine
Straßenbahn rumpelte vorbei. Zwei einbeinige Invaliden bewegten
sich mit Hilfe ihrer Krücken in Richtung Markt fort. Man kann
nicht sagen, dass sie sich schleppten, obwohl sie vielleicht ein
bisschen betrunken waren. Bei jeder Bewegung war die geschmeidige
Zusammenarbeit von Armmuskulatur und Rumpf zu erkennen. Es waren
Athleten.
Jetzt nötige ich mein heutiges Ich an denselben
Fensterplatz, auf dem ein Jüngling meines Namens vor fast einem
halben Jahrhundert saß. Das war nicht ich, obgleich ich das der
Einfachheit halber behaupte. Nicht ich. Ich, ich. Soll ihn der Teufel
holen!
Für alle Fälle sage ich jetzt ganz
eindeutig, dass ich mit der Romanfigur, für die ich den Namen
Pentti Holappa verwende, ganz und gar nicht mich selbst meine. Ich
setze mich nur der Demütigung aus, um einen anderen zu
schützen - Den Anderen?
Außerdem führe ich dich und andere
zusätzlich in die Irre, indem ich mit meinem eigenen Beruf
auftrete, als Schriftsteller.
Nehmen wir an, meine Romanfigur Pentti Holappa
wäre Ornithologe. Dann müßte ich mich notwendigerweise
zumindest oberflächlich mit Vogelkunde vertraut machen und in der
Lage sein, das Federkleid und den Gesang von Vögeln zu
beschreiben. Besonders diese zweite Aufgabe würde mir aufgrund
meiner fehlenden Musikalität Schwierigkeiten bereiten.
Einen Ingenieur könnte ich deswegen simulieren,
weil nach Ansicht der Intellektuellen keine Berufsgruppe dümmere
Angehörige hat. Ich dürfte aus vollem Herzen den Dummkopf
geben. Ich wäre komisch, obwohl ich kein Humorist bin, aber auch
diese Rolle würde mich ermüden, denn selbst ein dummer
Ingenieur weiß viele Dinge, die für mich reine Mystik sind.
Natürlich habe ich egoistische Gründe.
Indem ich mich opfere, mich als Zielscheibe für Boshaftigkeiten
anbiete, bin ich auch auf Ruhm aus, zumindest auf die Krümel
davon, die mir Asser möglicherweise von der festlichen Tafel kehrt.
Ein Masochist begnügt sich nicht mit dem
bloßen Schmerz.
Auch Assers so genannte >guten Freunde< oder
gar seine Geliebten erfassten von Assers Eigenart und Lebensschicksal
nicht mehr als den Schatten eines Schattens auf der Wand der
Eventualitäten.
Verzeihung! Ich taste mich weiter voran.
Ich sah also durch das Fenster zwei junge
Männer mit ihren Krücken. In den Jahren nach dem Krieg
begegnete man auf den Straßen der Hauptstadt andauernd jungen
Kriegsversehrten, Einbeinigen, Einarmigen. Man gewöhnte sich
daran. Schlimmer war es, in Gesichter zu blicken, die von Brandwunden
ruiniert waren, vor allem wenn unter der Haut schwarze Flecken vom
Sprengstoff zurückgeblieben waren. Vermutlich scheuen alle
Menschen von Natur aus Missbildungen. Unbewusst werden sie wohl als
Signale einer Krankheit und damit der Ansteckungsgefahr gedeutet. Wenn
sie unter Leuten waren, verbargen die Einbeinigen und Einarmigen ihre
Wunden unter den Kleidern, anders gesagt, sie falteten das leere
Hosenbein oder den leeren Ärmel doppelt und steckten ihn mit einer
Sicherheitsnadel fest, denn es gab zunächst nicht genügend
Prothesen für alle. In den öffentlichen Saunas und
Schwimmhallen konnte man sie ab und zu nackt sehen. Dann musste man
woanders hinschauen.
Ich war genauso herzlos, wie es junge Menschen
gemeinhin sind. Ich hatte kein Mitgefühl übrig für die
zwei Kriegsinvaliden, die kaum älter waren als ich.
Zwischenzeitlich lehnten sie sich in der Türnische des
gegenüberliegenden Bankgebäudes an. Dort kam der Nieselregen
nicht hin. Einer von ihnen zog eine Zigarettenschachtel aus der Tasche.
Die waren länglich und aus stabilem Karton. Er bot seinem
Kameraden eine an. Beide rauchten.
Sie hatten immerhin einander. Ich war ganz allein.
Ich wusste, dass die Wand hinter ihnen aus rotem
Granit war, aber im Dämmerlicht sah sie nur schmutzig aus. Ab und
zu rumpelten, wie gesagt, Straßenbahnen vorbei. Autoverkehr
existierte damals so gut wie gar nicht.
Mir knurrte der Magen. Ich war durch und durch
hungrig. Mein Vater war schon zu Beginn des Winterkriegs 1939 gefallen,
aber meine Mutter, meine Schwester und mein Bruder wohnten gemeinsam in
einem Zimmer mit Küche in Tampere. Mutter arbeitete in der
Leinenfabrik, mein Bruder als Maler in der Flugzeugfabrik und meine
Schwester in einer Schneiderei. Sie schickten mir Essen und ein wenig
Geld für die Wohnung. Ich hatte ein schlechtes Gewissen deswegen.
Ich war privilegiert. Mit welchem Recht?
Irgendwie mogelte ich mich von einem Tag und Monat
zum nächsten durch. Die Basis meines Lebensunterhalts erwarb ich
mir, indem ich noch vor dem Morgengrauen Zeitungen austrug, obwohl
meine Kräfte dafür nicht aus reichen wollten. Das Studium
litt darunter. Im Sommer arbeitete ich im Lager eines
Großhandels. Zur damaligen Zeit unterstützte die
Gesellschaft keine Studenten und auch sonst keine Minderbemittelten.
Nach dem Krieg wollten alle, die überlebt
hatten, nur Leben, essen und leben. Damals lebte man noch nicht im
globalen Dorf, die wenigsten wären in der Lage gewesen,
vorauszuahnen, auf weiches Verderben die Welt der Menschen zusteuerte.
Man wusste es nicht.
Ich sah auf die Straße hinaus und dachte
wieder daran, was mir am Morgen im Milchladen passiert war. Wenn die
Hungertage näher rückten, pflegte ich mir einen großen
Laib Brot zu kaufen, von dem ich täglich ein Stück als
Mahlzeit abschnitt. Das aß ich mit Wasser, zusätzliche
Energie bekam ich durch Zucker.
Beim letzten Einkauf war mir im Laden ein trockener
in die Hand gedrückt worden, und an diesem Morgen versuchte die
Verkäuferin den gleichen Trick noch einmal. Ich sah gewiss sehr
schüchtern und ungefährlich aus, aber diesmal protestierte
ich. Ich bekam einen frischen Laib anstelle des trockenen, aber die
Verkäuferin beschimpfte mich, sodass es die anderen Kunden
hörten, mit lauter Stimme als >verwöhnten Balg<. Sie
glaubte, was sie sagte. Die weiße Haube über den Haaren
zitterte vor Aufregung.
Ich war tief beleidigt, machte mich aber schnell davon.
Ich starrte auf meine innere Verletzung, bedauerte
mich selbst, als sich Asser Vaho, ohne um Erlaubnis zu bitten, an
meinen Tisch setzte.
Sollte ich dieses Ereignis mit einem banalen Satz abtun?
Ich versuche es mit einem Umweg, mit der Erinnerung
an einen frühen Film von Andrzej Wajda, in dem ein schöner
Engel durch das Dachfenster einer Toilette fällt, um die Seele
einer Putzfrau in eine glückseligere Wirklichkeit zu führen.
Wie dieser Engel erschien Asser Vaho in >meinem< Leben.
Jetzt die Fassung bewahren!
Kurze Zeit waren wir beide still. Ich war schlechter
Stimmung.
»Du schreibst doch Gedichte«, sagte Asser dann.
Er hatte mein Bild in der Zeitung gesehen. Das
beglich vieles. Ich bemühte mich, meine Genugtuung zu verbergen.
»Ich schreibe allerdings auch Prosa«,
entgegnete ich, »Erzählungen.«
»Großartig!« sagte er. »Mir
will das Schreiben nicht gelingen.«
Dann erzählte er, dass er an der
Kunsthochschule studierte, dass er um sich herum lauter Bilder sah, sie
waren im Überfluss da, dass er aber nicht vermochte, sie mit
Worten zu beschreiben. Wenn er es versuche, dann käme nur
Durcheinander zustande. Und genauso spreche er auch, ohne Hand und
Fuß.
Asser sprach außerordentlich schnell, das
stimmte, aber meiner Meinung nach nicht schlecht. Im Gegenteil,
beschwingt. Ich hingegen presste die Wörter nur mit Mühe aus
meinem Mund. In meinen Ohren hörte sich das nach Stottern an.
»Ich bin kein richtiger Schriftsteller«, behauptete ich.
Schließlich musste ich so tun, als wäre
ich bescheiden. Ich erzählte ihm, dass ich Finnisch sowie
Ästhetik und Literatur der modernen Völker zu studiere. Ich
nannte es langweilig. jedesmal wurde ich müde, wenn ich ein
Examensbuch aufschlug. Damals verriet ich noch nicht, dass ich nicht
genügend Schlaf bekam, weil ich mitten in der Nacht aufstehen
musste, um Zeitungen auszutragen.
»Aus dir wird ein Schriftsteller, ein
bedeutender. Das merkt man sofort.«
Er behauptete das, ohne den geringsten Anlass zu
haben, mir zu schmeicheln. Ich wusste, dass ich schäbig und
unbedeutend wirkte, aber vielleicht fiel etwas an mir auf. Vielleicht
lag eine Aura um mich, die ich selbst nicht sah.
Zumindest zehrte die Flamme des Ehrgeizes an mir.
Jetzt, nach langer Zeit, verstehe ich das richtig.
Bereits als Sechzehnjähriger begann ich damit,
meine Gedichte an Zeitungen zu schicken, und jedesmal bekam ich sie
zurück. Ich ließ mich nicht entmutigen. Zwei Jahre
später wurden die ersten von einer Wochenzeitung angenommen, und
bald darauf gewann eine Erzählung von mir bei einem Wettbewerb den
ersten Preis. Damals wurde mein Bild in einer großen Tageszeitung
veröffentlicht, und dieses Bild hatte Asser gesehen. Er hätte
daher wissen müssen, dass ich einen Wettbewerb für
Erzählungen gewonnen hatte.
Ich sehnte mich nach Anerkennung. Ich war so
alleine, und Asser kam zu mir wie eine himmlische Erscheinung. Er
blendete mich vom ersten Augenblick an - er blendete .mich, das ist das
richtige Verb.
»Nicht alles kann man mit Bildern
ausdrücken«, sagte er. »Denken wir nur an Al
Capone.«
Ich verstand nicht, was er meinte. Ich musste
lachen. Der amerikanische Gangster war im Winter zuvor gestorben.
Asser behauptete, in Al Capones Lebensgeschichte
ließe sich das Bild unserer Zeit erkennen, aber es war ein Bild,
das man nicht zeichnen und nicht malen konnte. Man brauchte Wörter.
Wir leben in einer Welt der Mörder. Die
Mörder ermorden sich gegenseitig, aber ihnen gehört die Welt.
Wer sich nicht an ihrem Spiel beteiligt, bleibt Zuschauer.
»Meinst du die Kriege?« fragte ich.
»Auch die Kriege«, bestätigte er und nickte.
»Dann ist es am klügsten, sich mit der
Rolle des Zuschauers zu begnügen«, sagte ich.
Ich war aufgrund eines kleinen Fußleidens von
der Armee befreit worden. Der Friedensvertrag verpflichtete Finnland,
seine Streitkräfte zu reduzieren, und so kam man schon mit einem
eindeutigen Scheingrund um den Dienst an der Waffe herum.
Überzeugung war auch dabei. Ich wollte nicht
töten lernen. Das sagte ich.
»Ganz richtig!« rief Asser aus.
»Das habe ich von dir erwartet.«
Vielleicht hatte er meine Erzählung gelesen.
Sie handelte von einem Deserteur. Damals war das noch ein
brandgefährliches Thema. Für Deserteure durfte man kein
Verständnis haben - schon gar nicht, wenn man kein Kommunist war.
Den Wettbewerb hatte ich trotzdem gewonnen. Logisch schien das nicht.
Asser war Fähnrich der Reserve. Seiner Ansicht
nach war die Armee ein Spiel für große Jungen. Na klar, auch
das fiel ihm leicht.
»Ist das Leben bloß ein Spiel?« fragte ich pathetisch.
Ich versuchte absichtlich Streit zu provozieren, um
mich auf diese Weise selbst herauszustellen.
»Nein, mein Junge«, sagte Asser,
»das ist es nicht. Du wärst im Stande, meine
Lebensgeschichte zu erzählen«, fuhr er fort.
Das sagte er tatsächlich! Merkwürdig, dass
mir das früher nicht eingefallen ist. Dann hätte ich keinen
Anlass für diese Erzählung suchen müssen. Er
ermächtigte mich, aber ihn zu schreiben, er bat gleich bei unserer
ersten Begegnung darum. Eine ganze Weile unterhielten wir uns
darüber.
Achtung! Dies ist meiner Meinung nach eine gut
erfundene Lüge.
»Gäbe es da etwas zu erzählen?« fragte ich.
»jetzt schon?«
-Du könntest es mit der Angst zu tun
bekommen«, entgegnete er und wirkte immer schicksalsschwerer.
Er tat nicht so als ob. Er starrte mit seinen
blendend blauen Augen bis in meinen innersten Kern. Das dichte blonde
Haar fiel ihm in die Stirn und verschattete seinen Blick.
Dann lachte er und war plötzlich ein anderer
Mensch. Er hatte einen vollen, sinnlichen Mund, aber er hätte
seine Zähne besser pflegen können. Sie wurden gelb.
Ich rauchte nicht, ich hätte es mir gar nicht
leisten können, aber Asser zündete sich eine Zigarette nach
der anderen an. Zwischendurch spielte er den Dandy und blies eine Reihe
kunstvoller Ringe in die Luft.
»Ich garantiere dir, dass du genügend
Erzählstoff zusammenbekommst«, versicherte er. »Ich
lebe entsprechend. Komm mit! Kommst du?«
...